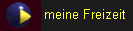|
| Ein
Bericht von Max Frisch |
||
| "Homo faber" | ||
| Premiere
am 14. Oktober 2017 |
||
| |
Regie: Hasko Weber | |
| Ausstattung: Sarah Antonia Rung | ||
 |
||
| Ein Mann legt Zeugnis ab: Walter Faber, Ingenieur aus der Schweiz, trifft auf einem Flug nach Mexico City zufällig den Bruder seines früheren Freundes Joachim. Kurz entschlossen begleitet er ihn durch den wuchernden Dschungel Guatemalas zu Joachims Farm, wo sie den Freund nur noch tot auffinden. Die Zufälle mehren sich. Walter trennt sich von der Geliebten, lernt unerkannt seine Tochter kennen, liebt sie zögerlich und macht sich unschuldig schuldig. Beide reisen gemeinsam nach Athen, wo sie ihre Mutter besuchen will und Walther inmitten einer Katastrophe der Frau seines Lebens wiederbegegnet. Die Spuren der Halbjüdin hatten sich vor dem 2. Weltkrieg verloren. Max Frischs Bericht,
1957 erschienen, ist einer der großen Würfe der Literatur
des 20. Jahrhunderts. Mit sinnlicher wie präziser Sprache thematisiert
Frisch (1911-1991) die zentrale Frage nach der Stellung des Menschen
zwischen Chaos und Struktur, zwischen Natur und Zivilisation, zwischen
Erlebnis und dem Versuch, das Erlebte mittels Sprache zu fassen. Sein
Held Walter Faber ist mehr als gefährdet, sich einseitig einem
Pol zuzuwenden. Als Techniker durch und durch hält er sich das
unstrukturierte Leben vom Leib. Drei unterschiedliche Frauen sind
es schließlich, die Begegnung mit einer jungen, neugierigen
Generation, die Konfrontation mit der Vergangenheit und eine vergleichsweise
zufällige Tragödie, die seine Weltsicht erschüttern.
Am Ende möchte er, so wie einst Ödipus, ohne Augen das Richtige
erkennen. Gierig greift er nach seinem einzigen Leben und schwelgt
darin mit der Atemlosigkeit des schwer Erkrankten. Text - Theater Chemnitz !!! |
||
| Die Premiere spielten: | ||
Walter
Faber
|
- |
Philipp Otto |
| Hanna
Piper, geborene Landsberg |
- |
Susanne Stein |
| Elisabeth
Piper |
- |
Seraina Leuenberger |
| Stewardess,
Ivy |
- |
Magda Decker |
| Marcel,
Hans Hartenstein, Williams |
- |
Martin Valdeig |
| Herbert
Hencke, Prof. O. |
- |
Dirk Glodde |
| KRITIK:
Schullektüre, klug verdichtet zu einem präzise wuchtigen Theaterabend: "Homo Faber" in Chemnitz. Homo Faber –
In Chemnitz erzählt Hasko Weber schnörkellos vom fehlbaren
Menschsein Und los. Wer braucht
schon eine Einleitung? Spot on und ohne Umschweife geht Walter Faber
in medias res, gelangt zum schmerzhaften Punkt: Das kann doch alles
nur Zufall sein. Eingerahmt von glänzender Metalloptik versichert
er sich und dem Publikum, dass er gar nicht anders handeln konnte, sein
schreckliches Tun aber dennoch eine Aneinanderkettung von Ereignissen,
kein Schicksal war. Dieser "Homo Faber" verzweifelt über
den Malus, als Mensch sein Menschsein nicht maschinen-analog regulieren
zu können. Hasko Weber hat Fabers "Bericht“ mit Präzision
und leiser Wucht in Chemnitz inszeniert. Beim Beinahe-Absturz
in der mexikanischen Wüste lernt Faber den Bruder eines vergessenen
Freundes kennen. Er erfährt, dass dieser der Ex seiner alten Liebe
Hanna ist. Er erinnert sich wieder an sie, die er mit einem Kind sitzenließ.
Ob sie ihm noch immer zürnt? Auf dem Schiffsweg nach Paris verliebt
er sich, ohne es zu wissen, in seine eigene Tochter Elisabeth. Ihre
gemeinsame Reise zu kulturgeschichtlich aufgeladenen Stätten endet
in der Katastrophe in Griechenland. Elisabeth verunglückt tödlich,
Walter begegnet Hanna wieder, muss nun vollends die Wahrheit seiner
inzestuösen Beziehung erkennen. Tobias Prüwer, nachtkritik, 15.10.2017 ___________________________________________________________
Unglaublich,
was dieser Vater und seine Tochter erlebt haben Der Ingenieur Walter Faber trifft auf einem Flug nach Mexiko auf Herbert, den Bruder eines Freundes. Als das Flugzeug abstürzt, bilden die beiden eine Zwangsgemeinschaft und es beginnt eine zufällige Kette von Ereignissen, die das Leben des strukturierten Faber auf den Kopf stellen. Das Stück wird getragen von der grandiosen Darstellung der Schauspieler, allen voran Philipp Otto, der als Walter Faber einen bedrückenden Blick auf die Welt und die Menschen liefert und in seiner Nüchternheit philosophisch wird. Das Gegenstück zu Faber ist Elisabeth, seine Geliebte und wie sich später herausstellt, Tochter. Gespielt wird "Sabeth" von Seraina Leuenberger mit kindlicher Leichtigkeit, die pure Lebensfreude versprüht. Ebenfalls im Gegensatz zu Faber steht Herbert, der durch verschiedene Ereignisse in seinem Leben resigniert wirkt. Gespielt wird er mit wunderbar trockenem Humor von Dirk Glodde. Die rund 100-minütige
Inszenierung (ohne Pause) von Hasko Weber (1993-2001 Schauspieldirektor
am Dresdner Theater) besticht durch ihre Einfachheit und ihren feinen
Sinn für Humor, der teilweise ins Sarkastische geht. Die Darsteller
stehen im Mittelpunkt und ihr Spiel wird nicht abgelenkt von einer erschlagenden
Kulisse oder zu vielen Effekten. Victoria Winkel, Chemnitzer Morgenpost, 16.10.2017 ___________________________________________________________
Unberechenbares
Leben Am Anfang Stille.
Walter Faber lehnt im korrekten Anzug an dem mit kühlen Metallplatten
beschlagenen Eisernen Vorhang. Gut sieht er aus, sicher wirkt er, nichts
lenkt ab von ihm. Und er sagt ... nichts. Ein, zwei, drei Minuten ohne
Text auf der Bühne könnten eine Ewigkeit sein. Doch in "Homo
faber", einem Stück nach Max Frischs berühmten Roman,
das am Samstag im Chemnitzer Schauspielhaus Premiere hatte, tritt genau
das Gegenteil ein. Sofort ist Spannung da. Philipp Otto in der Hauptrolle
schlägt in Bann - und die Inszenierung von Hasko Weber entlässt
das Publikum daraus erst, als die Hauptfigur am Boden liegt. Ein gescheiterter
Mensch auf der ganzen Linie. In den 100 Minuten der Inszenierung aber
kein einziger schwächelnder Moment. Uta Trinks, Freie Presse, 16.10.2017 ___________________________________________________________
Das unterkühlte
Menschengefängnis Walter Faber hätte
freiwillig ein Schauspielhaus nie betreten; seine große Liebe
Hanna nötigte ihn in jungen Jahren bisweilen dazu. Ein Stoff mit Ausmaßen einer antiken Tragödie Gleichwohl wird
Homo faber, der misanthropisch veranlagte technische Mensch, der sich
nichts aus Romanen und Kunst macht, der mit Museen so wenig anfangen
kann wie mit Bühnen, gerade deshalb immer wieder auf letztere genötigt.
Das Theater hat diese Figur des Jahres 1957, in dem sie auftauchte und
in dem sie handelt, als sehr moderne entdeckt. Bilder der Vergangenheit Das kommentiert
der Abend mit dem Kopf einer schlafenden Erinnye – antike Rachegöttin,
auf die Faber in Rom stößt – den sie hier hügelgroß
auf die Bühne wuchten (Ausstattung: Sarah Antonia Rung aus Weimar).
Er liegt da für mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als die Schulweisheit
sich träumen lässt. Dass Faber solche nicht sieht, nicht das
Widersprüchliche, Irrationale, Emotionale – „Gefühle
sind Ermüdungserscheinungen“ – ist sein Verhängnis. Michael Helbing, Thüringische Landeszeitung, 17.10.2017 ___________________________________________________________
Kreiselnde Rachegöttin Zufall oder Schicksal, und was kann er dafür? Mit einem Selbstmord wäre auch nichts gewonnen, sinniert am Ende ein leiser Walter Faber auf der Bühne, während die Rachegöttin schlafend wacht. Ungeschehen könnte er sein Tun selbst dann nicht machen, wenn er seine Existenz eigenhändig auslöscht. Ratlos gibt der Ingenieur Bericht darüber, wie ihm die Kontrolle über sein Leben entglitt. Dieser fällt von Beginn an eindrücklich packend aus. In sachlich-nüchterner Sprache schildert der technikgläubige Rationalist sein Dasein, das er wie eine Figur aus antiker Tragödie erleben muss. Mit Präzision und leiser Wucht entlädt sich Hasko Webers „Homo Faber“ am Schauspiel Chemnitz. Beim Beinahe-Absturz in der mexikanischen Wüste lernt Walter den Bruder eines vergessenen Freundes kennen. Er erfährt, dass jener der Ex seiner alten Liebe Hanna ist. Und erinnert sich wieder an sie, die er mit einem Kind sitzen ließ. Ob sie ihm noch immer zürnt? Auf dem Schiffsweg nach Paris verliebt er sich, ohne es zu wissen, in seine eigene Tochter Elisabeth. Ihre gemeinsame Reise zu kulturgeschichtlich aufgeladenen Stätten endet in der Katastrophe in Griechenland. Elisabeth verunglückt tödlich, Walter begegnet Hanna wieder, muss nun vollends die Wahrheit seiner inzestuösen Beziehung erkennen. Max Frischs Roman stach 1957 mitten hinein in die tobende Debatte ums Verhältnis von Technik und Kultur, von Natur- und Geisteswissenschaften. Webers klug zum Stationendrama gestrichenen Text fehlt es an philosophischer Tiefe nicht. Er lässt wohldosierte Reflexionen über Schicksal und Kausalität, Werkzeug- und Kulturmensch zu. Das gelingt als pointiertes Sprechtheater. Insbesondere Philipp Otto kann seinen Walter Faber nuancenreich vom kühl kalkulierenden über den schwelgerisch verliebten bis zum am Fatum verzweifelnden Charakter geben. Als jugendlich-altkluge und leidenschaftlich-unbedarfte Elisabeth lässt Seraina Leuenberger dessen Herz höher schlagen. Kein Hauch von Gretchen oder Käthchen hängt ihr an. Dramaturgisch geschickt wechseln sich Spiel- und Erzählmomente ab, gehen die Episodenszenen bruchlos ineinander über. Das Überblenden von Dialogen und inneren Monologen Walters – mitten im Gespräch friert dieses ein und er sagt etwas zu sich – schafft Verdichtung. Dezente Regieideen wie eine grotesk gestikulierende Stewardess beim Absturzkollaps gefallen als theatraler Beistand. Das reduzierte, flexible Bühnenbild unterstützt das flotte, aber nicht überhastete Inszenierungstempo. Nur zum Schluss
hin zeigt sich ein imponierendes Bild. Übergroß kreiselt
der Kopf der schlafenden Rachegöttin auf der Drehbühne. Zuerst
sitzt Elisabeth lässig oben auf, genießt die Aussicht. Dann
befindet sie sich verrenkt daneben auf der Erde. Walter Faber ist jegliche
Kontrolle entfallen, auch die tour de force durch die Kulturschichten
konnte sein Schicksal nicht abwenden. Technik und Mythos, Vernunft und
Gefühl schienen einen Moment in der Kunst versöhnt. Dann platzt
der schöne Traum, zeigt sich hohl. Leer wie der Göttinnenschädel,
in den man im finalen Bild von hinten hineinglotzt. Homo Faber, das
schaffende Geschöpf, bettet sich zu Boden. Das Licht erlischt. Tobias Prüwer, Sächsische Zeitung, 18.10.2017 ___________________________________________________________
„Immer wieder
blitzt er auf, der Diskurs über Wohl und Wehe des technischen Fortschritts,
wie er damals tobte, als Max Frisch seinen Bericht schrieb und Faber
als Ingenieur in die Verhandlung schickte.“ Endlich vertraut mal wieder einer auf die ureigenen Mittel des Theaters: auf die Schauspieler, auf den Text, auf die Semiotik... Das geht gleich gut los. Die Bühne von Sarah Antonia Rung ist einfach verblecht und genietet - Flugzeug, na klar. Zwei Männer sitzen dort auf Hockern und wollen nach Mexico City. Dann stürzt die Maschine über der Wüste beinahe ab, was die beiden nicht weiter aufregt. Auch die Stewardess spricht grundsätzlich beruhigende Worte, während sie allerdings komplett in Panik gerät. Und schon ist klar: Diese Inszenierung wird auch vom Subtext leben. Vor allem jedoch von der Verabredung, immer bei der Frage zu bleiben, was da ist oder nicht ist zwischen Himmel und Erde, Irrationalem und Rationalem, Natur und Kultur. Warum entschließt sich Faber, mit Herbert nach Guatemala zu reisen, wo er den Deutschen doch gerade erst auf dem Flug kennengelernt hatte und ihn eigentlich gar nicht mochte? Freilich, er ist der Bruder eines Studienfreundes. Mit ihm könnte er Joachim wiedertreffen - oder aber erfahren, wie es Hanna geht, seiner großen Jugendliebe, die Joachim später geheiratet hatte. Jedenfalls bringt die zufällige Begegnung alles ins Rollen: dass sich Faber von Ivy trennt, er per Schiff nach Europa reist, auf der Passage die junge Sabeth kennenlernt, sich verliebt und mit ihr quer durch Europa tourt, erfährt, dass sie seine Tochter ist, er Hanna tatsächlich wiedertrifft - und er schließlich in der Katastrophe endet und nachdenken muss, wie und wann und warum er sich schuldig gemacht hat. Das alles packt das Team unter Leitung von Regisseur Hasko Weber in eine Szenenfolge mit großer philosophischer Tiefe und packender Konzentriertheit, die immer wieder unterbricht - für Selbstreflexionen Fabers, für Rückblenden, für Vorwegnahmen, für Ausführungen zu den großen Diskursen der Welt, für Brüche, Abschweifungen. Trotzdem oder vielmehr deshalb bleibt das Geschehen schlüssig und spannend. Nicht zuletzt auch wegen des wunderbaren Ensembles, einer so stolzen wie gebrochenen Susanne Stein, einer durchgedrehten Magda Decker, einer unbedarft-schwärmerischen Seraina Leuenberger, eines intellektuellen Martin Valdeig, eines desillusionierten Dirk Glodde und eines grandiosen Philipp Otto als Faber. Herrlich wie er zwischen nüchterner Weltbetrachtung und innerem Aufgewühltsein balanciert, wie er die zunehmende Verunsicherung spüren aber nicht hören lässt, wie er die rationale Sprache mit Nuancen füllt. Immer wieder blitzt er auf, der Diskurs über Wohl und Wehe des technischen Fortschritts, wie er damals tobte, als Max Frisch seinen Bericht schrieb und Faber als Ingenieur in die Verhandlung schickte. Gut 60 Jahre später zeigt Hasko Weber, dass der gesellschaftliche Dialog noch immer der gleiche ist, vielleicht auch mit digitaler Prägung. Gefühle seien
Ermüdungserscheinungen, sagt sein Titelheld und legt sich am Ende
erschöpft nieder - im Hintergrund die Großplastik einer antiken
Erinnye. Jenny Zichner, Stadtstreicher, 11.2017 ___________________________________________________________ Die Unberechenbarkeit des Lebens Vor und nach der Premiere unterhielten sich manche im Publikum über Hasko Webers früheres Schaffen am Chemnitzer Theater, denn Weber ist hier fast eine Legende aus Vorwende- und Wendezeiten. Von 1987 bis 1989 studierte er am Karl-Marx-Stadter Schauspielstudio und wurde 1989 vom Intendanten Gerhard Meyer als Schauspieler und Regisseur engagiert. Er gründete mit anderen Absolventen des Schauspielstudiums die Dramatische Brigade, die mit Anbindung an das Schauspielhaus selbstständig über ihre Inszenierungsplane entschied. Hasko Weber war der Regisseur von Sophokles’ „Antigone“, Christoph Heins „Schlötel oder Was solls“, Ibsens „Klein Eyolf“, Nigel Williams’ „Klassen Feind“ und Kleists „Die Familie Schroffenstein“. Doch die Dramatische Brigade zerfiel in der politisch bewegten Zeit durch die Ausreise von Mitgliedern, weshalb auch die schone Inszenierung von „Schlötel oder Was solls“ nicht mehr gespielt werden konnte. Dabei war diese, wie aus den Stasi-Akten bekannt wurde, ihrem Verbot entgangen, weil sie in einem nur fünfzig Zuschauer fassenden Raum gezeigt wurde. „Homo Faber“ beginnt mit Stille. Eine Hand in der Hosentasche seines Anzugs, so lehnt Walter Faber am genieteten Plattenstahl der Rückwand (da ist jemand vernagelt und borniert) auf leerer Bühne. Er sagt – nichts. Wenn dann der von Vernunft bestimmte Faber über wahrscheinliche und unwahrscheinliche Ergebnisse beim Würfelwurf nachdenkt, gibt sein Darsteller Philipp Otto dem noch immer Nicht-Geschehen ohne jedes gestisch-mimische Auftrumpfen eine spannungsvolle Konzentration. Ganz bewusst überführt Weber Frischs didaktisch behäbigen Text nicht in viele szenische Aktivitäten, sondern verdichtet die von Faber im Monolog erzählte Geschichte. Auch die Dialoge mit den Menschen, die ihm auf seinen Flügen für die UNESCO durch Sudamerika begegnen, sind zwischen Reflexion und Bericht angelegt. So entsteht eine Inszenierung, die sich äußere Spielhektik versagt, aber von den Darstellern mit innerer Spannung aufgeladen wird. Auch besitzt Weber mit Philipp Otto einen Hauptdarsteller, der die Sätze des Autors mit Intensität und Kraft auflädt. Sein rationalistischer Homo Faber glaubt nicht an Schicksal. Doch als es bei einem Flug nach Mexiko zu einer Notlandung in der Wüste kommt, erweist sich der Mitreisende Herbert (Dirk Glodde) als Bruder von Fabers Jugendfreund Joachim. Faber fährt mit Herbert durch den Dschungel zur Plantage Joachims. Joachim wiederum hat Fabers Jugendliebe Hanna geheiratet. Nun hofft Faber, etwas über Hannas weiteres Schicksal zu erfahren; vergeblich – Joachim hat sich erhängt. Der an Technik und Beherrschbarkeit des Lebens glaubende Rationalist Faber, für den Gefühle nur bezwingbare Ermüdungserscheinungen sind, erlebt nun einen Schicksalsschlag nach dem anderen. Bühnenbildnerin Sarah Antonia Rung hat schone und funktionale, fast leere Raume gebaut: Eine offene Gangway dreht sich im leeren Raum, und für eine Flugreise braucht es nicht mehr als eine Stewardess zwischen zwei Männern auf Metallhockern. Die zwischen Spiel und Erzählung geschickt wechselnden Szenen entwickeln sinnliche Kraft, und die etwas klischeehafte Szene, in der sich Faber in New York von seiner verheirateten Freundin Ivy (Magda Decker) trennt, besitzt Witz. Hanna (Susanne Stein), deren heftige Emotionalität beim erneuten Zusammentreffen mit Faber durch einen rot wallenden Vorhang verdeutlicht werden soll, hat damals ohne dessen Wissen nicht abgetrieben und eine Tochter geboren. Als Faber auf einer Schiffsreise die junge Elisabeth kennenlernt, weiß er nicht, dass sie seine Tochter ist und dass er mit ihr Inzest begeht. Seraina Leuenberger gibt der Inszenierung Kraft und Lebendigkeit. Ihre Elisabeth ist eine zugleich poetische wie selbstbewusst sinnliche junge Frau. Dass sie sich in den älteren Mann verliebt und mit ihm ins Bett geht, überlebt sie aber nicht. In Akrokorinth von einer Giftschlange gebissen, fallt sie von der riesigen Statue einer schlafenden Erinnye und stirbt im Krankenhaus. So endet die Inszenierung
wie eine griechische Tragödie. Faber, der seine Welt als erklärbar
und beherrschbar ansah, hat eine Serie von Katastrophen erlebt und liegt
am Ende niedergestreckt auf dem Boden. Auf die zweite Station von Frischs
„Homo Faber“ verzichtet Hasko Weber. Das Publikum jubelte
und wollte in verständlicher Begeisterung über diese schnörkellos
konzentrierte Inszenierung nicht aufhören zu applaudieren. Weber
ist nach Chemnitz zurückgekommen, mit einer inszenatorisch und
dramaturgisch überzeugenden Arbeit. Da konnte man begeistert sein. Hartmut Krug, Theater der Zeit, 12.2017 ___________________________________________________________ Technik und Tabu Gibt es solche Männer wie Walter Faber eigentlich noch? Typen, die ihren Ingenieursberuf nicht nur deshalb so schätzen, weil er strikt auf Logik basiert, sondern auch, weil er ihnen Anlass gibt, sich vor den angeblichen irrationalen Wünschen und Forderungen ihrer Geliebten und Lebensgefährtinnen zu verdrücken? Männer, die beim Assoziationspingpong in einer griechischen Nacht die Brandung am Strand mit Bierschaum und Glaswolle vergleichen (während die weibliche Mitspielerin an eine Rüsche denkt)? Die sich an Technik klammern in der Hoffnung, sie möge ihnen das Unglück vom Leibe halten, in die das Leben noch den Vernünftigsten stürzt? Am Schauspiel Chemnitz ist Walter Faber sicherheitshalber eine historische Figur. Max Frischs Roman „Homo faber“ spielt in den fünfziger Jahren in New York, Guatemala, auf dem Atlantik, in Frankreich, Italien und Athen; der zweite Weltkrieg, der Holocaust schwappen noch als Vorgeschichte in die Handlung hinein. Flugzeuge, Kreuzfahrtschiffe, Autos bewegen die Protagonisten dieses in jeder Hinsicht modernen Romans auf die Katastrophe zu, auch wenn der Flugzeugabsturz glimpflich abläuft, der tödliche Sturz zu Fuß erfolgt und die wahre Tragödie am Ende so alt ist wie die Ruinen auf der Peleponnes, für die sich Hanna, die Mutter von Fabers Tochter, so interessiert. Sara Antonia Rungs schlichte Vorhangkonstruktion aus vernieteten Metallplatten erinnert an die Außenhaut der abgestürzten Super Constallation, davor ist New York mit der modischen Ivy (Magda Decker), dahinter Guatemala samt Jugendfreund Joachim (Dirk Glodde), der als Kolonialherr Dschungel und Einsamkeit nicht überlebt. Obwohl Regisseur Hasko Weber und sein Team den Roman gut gekürzt und geschickt auf fünf Mitspieler*innen verteilt haben, ruht die Textlast eindeutig auf Philipp Ottos sonorer Stimme, die selbst gedämpft noch mühelos Schläfer in der letzten Theaterreihe aufwecken kann. In Webers Inszenierung, deren zurückhaltende Schlichtheit zwischen elegant und ein bisschen fade angesiedelt ist, bleibt er das unangefochtene, etwas zu ungebrochene Zentrum. Otto zeigt Faber als Gepanzerten, der sich vor seinen Gefühlen in Sicherheit bringen und deshalb cooler und lakonischer rüberkommen muss, als er ist: Generation Flakhelfer eben. Die Fassade bröckelt leicht, als er auf panischer Flucht vor Ivys Heiratswünschen ein Schiff nach Europa besteigt und darauf Sabeth begegnet. Auf einem angeschrägten Stück Reling schließen die beiden Bekanntschaft, fühlen sich angezogen, vermeintlich als Gegensätze: Wo Faber die Welt technisch analysiert, erfährt Sabeth sie im offenen Austausch und durch Poesie. Seraina Leuenberger beeindruckt mit einer feinen Natürlichkeit, kann aber auch nichts daran ändern, dass diese Liebe so ziemlich jedem abgedroschenen Geschlechterklischee entspricht. Dass Faber in ein
waschechtes Inzestdrama geschlittert ist, kapiert er erst, als Sabeth
im Krankenhaus an einer Gehirnblutung stirbt und er sich vor einem riesigen,
übermannshohen Erinnyenkopf mit seiner Ex-Freundin Hanna (Susanne
Stein) austauscht. Das Kind, von dem er vor über 20 Jahren nichts
wissen wollte, hat sie dann doch bekommen – nicht etwa von Joachim,
wie Faber sich permanent einzureden versuchte. Mehr noch als die mehrfache
Katastrophe – Frau im Stich gelassen, Inzesttabu gebrochen, Tochter
tot – bedeutet ihn die eigenen Logikfehler und Versäumnisse.
Dass er darüber zum Feministen wird, ist nicht zu befürchten. Eva Behrendt, Theater Heute, 01.2018 ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
|
||
| |
||
| Erstellt am 25.06.2021 | |||