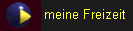|
|
Christoph
Hein
|
||
| "Die wahre Geschichte des Ah Q" | ||
|
Premiere
am 10. Januar 1992
|
||
|
|
Regie: Klaus Tews | |
| Bühne: Volker Walther | ||
| Christoph Hein zählt mit seinen Romanen („Der fremde Freund", „Horns Ende", „Der Tangospieler"), seinen Reden und Essays, seinen Theaterstücken (vor allem „Die Ritter der Tafelrunde") zu den profiliertesten Vorbereitern einer geistigen Wende in der DDR. Sein Stück „Die wahre Geschichte des Ah Q", 1984 am Deutschen Theater Berlin uraufgeführt, ist eine freie Bearbeitung der gleichnamigen Novelle von Lu Xun (1881 -1936), des auch in Europa vielgelesenen "chinesischen Gorki" . | ||
 |
||
| Das Stück schildert die Geschichte der beiden Landstreicher Ah Q undWang, die Unterkunft in einem Tempel finden, die von einer besseren Zukunft und von der Revolution träumen, ohne etwas dafür zu tun und deshalb von den Geschehnissen überrollt werden. Hein liefert eine Geschichte, die heute wahrscheinlich noch aktueller ist, als sie es in der Zeit ihrer Entstehung war, über Macht und Ohnmacht, über individuelles Träumen und gesellschaftliche Realität. Edelmann Ihr Interesse an der Novelle, war das dieses Moment der Suche nach der Revolution, der Frage danach, wo denn die Revolution eigentlich geblieben ist? Hein Nein, das Interesse an der Novelle war eigentlich weitestgehend das Interesse an der Ah Q-Figur selbst, an diesem Vertreter einer Zwischenschicht - bei Lu Xun ist Ah Q ja ein Arbeitsloser, gehört zur Dorfarmut. | ||
|
Die Premiere spielten: |
||
|
Ah Q |
- |
Bernd-Michael Baier |
|
Wang, genannt
Krätzebart |
- |
Andreas Haase |
|
ein Tempelwächter |
- |
Frank Höhnerbach |
|
eine Nonne |
- |
Gitta Schweighöfer |
|
Maske, der
Dorfpolizist |
- |
Stefan Schweninger |
|
KRITIK: „Die wahre Geschichte des Ah Q" im Chemnitzer Schauspielhaus - erstmals im Osten Deutschlands nach der Wende wieder inszeniert - erfolgreich zur Premiere gebracht, erweist sich als ein Stück Dramatik von viel umfassenderem Zugriff als vielleicht noch Mitte der 80er Jahre gedacht, da es an den Bühnen der ehemaligen DDR relativ viel gespielt wurde. Das macht einen Theaterbesuch heute außerordentlich spannend. Die Leute im Parkett sehen Christoph Heins damals viel diskutiertes Stück mit einem Bündel völlig neuer Erfahrungen, die ihnen die vergangenen reichlich zwei Jahre beschert haben. Und siehe da, der „Ah Q" hat nichts von seiner Brisanz verloren. Hein, der das Stück nie als bloße Gesellschaftskritik verstanden wissen wollte, hilft den Gedanken der Zuschauer nach wie vor auf die Sprünge. Auf Antworten freilich ist das Stück nicht aus, und Regisseur Klaus Tews, der damit in Chemnitz seine zweite Inszenierung vorstellt, folgt den Intentionen des Autors strikt, der lediglich zu bedenken gibt, daß die Träume der Menschen an ihrer eigenen Unentschiedenheit scheitern, der fragt, welche Rolle der einzelne überhaupt in der Geschichte spielt, was Lebenskonzepte taugen. Uta Trinks, Freie Presse, 13.01.1992
1983 schrieb Christoph Hein „Die wahre Geschichte des Ah Q" nach einer Novelle Lu Xuns. Es ist eine Philosophie über „die Kleinen" der Welt; bei Lu Xun die Dorfarmut, bei Hein die Intelligenz. Sie schwingen große Reden und wollen eine große Welt verändern. Und verharren in ihrem kleinen Elend aus Angst, sich tatsächlich zu engagieren und damit zu gefährden. (Und die sich gefährden, ändern nichts). Geschichte einer verreckten Revolution. Sie entblößt Lebensweisheiten, die an Orte nicht gebunden sind. Der lebensbejahende Pfiffikus Ah Q (Bernd-Michael Baier) liegt im Dreck und häufig auf der Nase. Ihn ficht es nicht an. Neben ihm liegt Wang, genannt Krätzebart (Andreas Haase). Er ist der ewige Intellektuelle, der die Welt zwar begreift, doch unfähig ist, sie zu ändern. Die „Revolution" verschlafen beide. Das Wasser tropft durchs lecke Dach in blecherne Eimer, Schüsseln, Wannen. Ping, ping, pong ... Der gnädige Herr heißt nun revolutionärer Herr, und die Nonne Maria (Gitta Schweigböfer) lebt im „revolutionären Kloster zur unbefleckten Empfängnis". Die Hoffnungen aller Krätzebärte dieser Welt haben längst stattgefunden. Ohne sie. Gegen sie. Regisseur Klaus Tews ist ein Schlitzohr - und er sei dafür bedankt. Er beläßt der Fabel ihre Unabhängigkeit von Ort und Zeit. Keine neudeutsch anbiederischen Rufe von Volk und Volker. Durch diesen „Verzicht" bewahrt Tews dem Stück Würde und Aktualität. Ein stilles Bravo dem Ensemble, in dem Frank Höhnerbach wenigstens erwähnt sei. Das Gespann Baier und Haase sowieso, bemerkenswert die Leiterartistik des ersteren, und die Geistesartistik mancher im Saal, lachend eigene Pointen zu setzen. Ich bin gegen alles, du bist gegen alles. Aber sie wissen nicht, was. phil, Junge Welt 13.01.1992 |
||
|
|
||
| Erstellt am 17.03.2001 | |||